Im Botanischen Garten SZTE begann die naturschutzbezogene Forschung in den frühen 2000er Jahren. An folgenden Pflanzenarten wurden reproduktionsbiologische Untersuchungen durchgeführt: Frühlingsprimel (Primel veris), stammlose Primel (Primel vulgaris), Sibirisches Rosenblatt (Iris sibirica), medizinische Verleumdung (Acorus calamus), Lammbraten (Alcanna tinctoria).
Seit 2006 ist der Kiskunság-Nationalpark an der LIFE-Ausschreibung beteiligt, und der Forschungsschwerpunkt hat sich auf die ex situ (lebensraumferne) Pflanzenvermehrung verlagert.
Neben dem Nationalpark Kiskunság besteht seit 2011 auch eine aktive Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Körös-Maros. Der Füvészkert ist der ideale Standort für die Ex-situ-Pflanzenvermehrung (entfernt vom Lebensraum), und die im Garten angebauten Pflanzen werden dann in Nationalparkgebieten gepflanzt und tragen so zur Erhaltung der Artenvielfalt des Gebiets bei.
Nachfolgend finden Sie einen kurzen Überblick über die Forschungsthemen, die im Botanischen Garten SZTE von 2006 bis heute durchgeführt wurden.
Schutz einheimischer mehrjähriger Nelken, LIFE-Natur-Projekt, 2006-2011
Die ausdauernde Nelke (Dianthus diutinus) einheimische Pflanzenart in Ungarn. Es handelt sich um eine stark geschützte Pflanze mit einem Schutzwert von 250 000 HUF, deren natürlicher Lebensraum die sandigen Wiesen zwischen Donau und Theiß sind. Heute sind ihre Bestände und die Anzahl der Individuen stark zurückgegangen.
Ziel der 2006 gestarteten LIFE-Anwendung war es, die natürlichen Lebensräume der Pflanze und die Anzahl der dort lebenden Wurzeln zu kartieren, geeignete Lebensräume zu schaffen, die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten durch Unterdrückung zu unterstützen und das Überleben zu unterstützen der natürlichen Population durch Anpflanzung ex situ vermehrter Pflanzen. Die Ausschreibung umfasste drei Projektgebiete: Csévharaszt (Donau-Ipoly-Nationalpark), Bodoglár und Bócsa (Kiskunság-Nationalpark).
Im Rahmen der Ausschreibung verpflichtete sich der Botanische Garten SZTE, 15.000 Pflanzen ex situ aus Samen zu vermehren, die von natürlichen Beständen gesammelt wurden, und sie in den ausgewiesenen Gebieten neu zu pflanzen.
Die Arbeiten wurden im Rahmen des LIFE-Natur-Projektes (LIFE06 NAT/H/000104) mit dem Titel „Schutz der Pannonischen Staudennelke“ durchgeführt und Ende 2011 erfolgreich abgeschlossen.
mehr Details:
Nemeth, A; Makra, O. (2011): Ex-situ-Schutz der Staudennelke (Dianthus diutinus) – Fallbeispiel – in: Gy. Verő (Hrsg.): Naturschutz und Forschung am Sandrücken zwischen Donau und Theiß, Rosalia Band 6 , Nationalparkdirektion Duna-Ipoly, Budapest 2011, 353-380. (herunterladen)
http://www.tartosszegfu.hu/uploads/layman_magyar.pdf
http://longlastingpink.eu/uploads/layman_angol.pdf
Über das Projekt wurde unter der Regie von Szabolcs Mosonyi auch ein Film gedreht:
Anpflanzung und Nachsorge von Löss-Spezialpflanzenarten im Körös-Maros-Nationalpark, 2011-2012
Im Auftrag des Nationalparks Körös-Maros hat sich der Botanische Garten SZTE verpflichtet, von Mai 2011 bis Herbst 2012 die Propagules (Vermehrungsformeln) von 41 Arten seltener, gefährdeter und/oder geschützter Lösspflanzen im Nationalparkgebiet zu sammeln und züchte Setzlinge, die zum Pflanzen geeignet sind. Die gewachsenen Pflanzen werden auf Ödland unter Verwaltung des Nationalparks gepflanzt, die sich in verschiedenen Stadien der Regeneration befinden.
Die Propagula wurden 2011 gesammelt und die Vermehrungsarbeiten fanden 2011-2012 statt. Die Pflanzen wurden im Herbst 2012 in das Steppengebiet Kopáncsi verpflanzt. An 9 Standorten wurden insgesamt 5.914 Setzlinge der folgenden Arten gepflanzt:silene Otitis), tuberöse Hoden (Phlomis tuberosa), fette Würze (Senecio doria), eingetopftes Fächergras (Filipendula vulgaris), schmutzige Ranken (Ajuga laxmannii), kleinblütige Segge (Astragalus austriacus), Sie sind ein rüpelhafter Haufen (Peucedanum alsaticum), Wüste (Vinca herbacea) Speerhecht (Scutellaria hastifolia), große Krähenbohne (Hylotelephium telephium ssp. Maximum), Johanniskraut (Senecio jacobaea), Gemeiner Poison Ivy (Vincetoxicum hirundinaria), Sichel gamandor (Teucrium chamaedrys), zylindrischer Rand (Inula germanica), mit Kapuze violett (Viola ambigua), Salatkürbis (Ranunculus ficaria), Bergflachs (Linum austriacum), Kaninchenfell (Ornithogalum brevistylum), gerade Nippel (Potentilla recta), Österreichischer Weiser (Salvia austriaca), gór Schaum Nelke (Silene bupleuroides), Zwergmandel (Amygdalus nana) usw.
Die Arbeiten wurden im Rahmen der Ausschreibung KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0013 für die Anpflanzung und Nachsorge von Löszgyep-Spezialpflanzenarten auf den angegebenen topografischen Nummern durchgeführt.Die genaue Beschreibung finden Sie im folgenden Artikel:
http://kmnp.hu/_user/browser/File/2015/Crisicum%20VIII/045_076_Nemeth_Fuveszkert_2014.pdf
Reproduktionsbiologische und ex situ Vermehrungsmethodische Studien der hochgeschützten Woll-Segge (Astragalus dasyanthus Pall.) in seinen natürlichen Ständen, oder mit daraus gesammelten Samen, 2017-2018
Das wollige Szüdgras in geschlossenem und offenem Sand bzw eine seltene, stark geschützte Schmetterlingspflanze, die in Lösswiesen vorkommt. Seine Seltenheit rechtfertigte die reproduktionsbiologische Untersuchung einer natürlichen Population.
Die Tests wurden in Seggenpopulationen durchgeführt, die in drei sandigen Lebensräumen des Kiskunság-Nationalparks mit unterschiedlichen Mikroklima- und Reliefbedingungen (in der Nähe von Pirtó, Kisszállás, Bócsa) mit insgesamt 145 Individuen leben. Bei der Auswahl haben wir versucht, zufällig Individuen auszuwählen, die alle Entwicklungsstadien repräsentieren (in vegetativem Zustand, in Blüte, mit wenigen Trieben, sehr stark, reich blühend usw.).
Die Probenahme erfolgte einmal pro Woche vom Blütenknospenstadium bis zur Blüte. Die Vitalität der Individuen, die Anzahl der Blütentriebe an den Stängeln, die Anzahl der Blütenstände an den Triebköpfen, bzw die Dauer der Blüte und der Erfolg des Fruchtansatzes wurden aufgezeichnet. Wir führten auch Pollenlebensfähigkeitstests durch, indem wir Staubbeutel von den Blüten sammelten. Wir haben auch Raubtiere erfasst, die Pflanzen und Blumen auf dem Feld beschädigen.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Blütezeit in den drei Gebieten zu unterschiedlichen Zeiten auftrat. Es war zuerst in Pirtó (3. Maiwoche), dann in Bócsá und schließlich in Kisszállás. Dann blühten die Individuen 80-90% und begannen mit der Fruchtreife, wobei eine ähnliche einwöchige Verschiebung in den drei Bereichen beobachtet wurde. Die durchschnittliche Anzahl der Blütenstände war im Bócsa-Bestand am höchsten, etwas weniger im Pirtó-Bestand, während der kleine Bestand bemerkenswert niedrig war.
Die Ernte der reifen Früchte und Samen begann Ende Juni. Wir fanden signifikante Unterschiede zwischen den Musterflächen in Bezug auf die Anzahl der Blüten pro Blütenstand und den Erfolg des Fruchtansatzes. In Bócsá hatte ein Blütenstand durchschnittlich 14 Blüten, während in Pirtó und Kisszállás ein Blütenstand normalerweise 10-11 Blüten hatte. In Bócsán haben wir – trotz der größeren Blütenstände und Zierlichkeit sowie der späteren Blüte – deutlich weniger Fruchtansatz erlebt. Die Small-House-Population kompensierte die geringere durchschnittliche Anzahl von Blütenständen, indem sie mehr Sameninitiierung pro Blüte produzierte, aus der lebensfähige Samen mit 601 TP3T-Erfolg gebildet wurden. Andererseits wurden in der Bócsa-Population mit einer großen Anzahl von Individuen signifikant weniger Sameninitiationen in den Blüten gebildet und lebensfähige Samen wurden in einem signifikant geringeren Anteil produziert (30%).
Es gab einen signifikanten Unterschied in der Pollenproduktion zwischen Sammelzeiten und Probengebieten, aber die Pollenlebensfähigkeit ist wahrscheinlich kein limitierender Faktor für den Fortpflanzungserfolg der Art.
Trotz der großen Blütenproduktion beobachteten wir bei allen drei Populationen einen sehr schwachen Fruchtansatz.
Mit einem Aussaatversuch wurde die Keimfähigkeit der im Freiland gesammelten Samen getestet. Die Aussaat erfolgte in einer Lichtkammer, die Samen wurden vorher angeritzt. Die Samen aus den drei Bereichen wurden in getrennte Saatschalen gesät. In der Lichtkammer sind die Samen ca. Nach 4 Tagen begannen sie zu keimen. Die vermehrten Pflanzen wurden an die Mitarbeiter des Nationalparks Kiskunság übergeben und entsprechend ihrer Herkunft umgesiedelt.
Wiederherstellung von Lössmoorwiesen im Körös-Maros-Nationalpark durch Vermehrung und Anpflanzung charakteristischer/spezialisierter Pflanzenarten, 2017–2021
Das derzeit laufende Projekt kann als Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit mit dem Körös-Maros-Nationalpark betrachtet werden, die 2012 erfolgreich abgeschlossen wurde (wie durch die jährliche Zustandsbewertung bestätigt), mit einer erweiterten Artenliste und der Aufnahme neuer Gebiete. Das neue Lössgrasland-Rehabilitationsprojekt des Körös-Maros-Nationalparks aus dem Jahr 2017 zielt darauf ab, seltene, gefährdete und/oder geschützte Pflanzenarten, die typisch für Lössgrasländer sind, im Verwaltungsgebiet des Nationalparks auf Brachflächen in verschiedenen Stadien der Wiederbepflanzung zu vermehren und neu anzupflanzen. Das Projekt trägt den Titel „Wiederherstellung von Lössmoorwiesen im Körös-Maros-Nationalpark durch Vermehrung und Anpflanzung charakteristischer/spezialisierter Pflanzenarten“. Die Implementierung erfolgt im Rahmen der Anwendung KEHOP-4.1.0-15-2016-00040. Im Rahmen des Auftrags übernahm der Botanische Garten SZTE die Feldsammlung von Propagulen (Vermehrungsformen) von 83 Lössgraslandpflanzenarten. Einige der gesammelten Vermehrungspflanzen werden durch Aussaat auf die zur Regeneration vorgesehenen Flächen verteilt, bei anderen Arten werden zum Anpflanzen geeignete Einzelpflanzen gezüchtet (Ex-situ-Vermehrung) und die Setzlinge in einem vorab festgelegten Netz auf die dafür vorgesehenen Flächen verpflanzt. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Phasen und werden 2021 abgeschlossen sein. Von der Samenverbreitung betroffene Arten: Frühlingszwiebel (Lauch rotundum), Wasserschlauch (Astragalus Kichererbse), Pfefferkorn (Clinopodium vulgare), ungarische Nelke (Dianthus pontederae), Mädesüß (Knautia arvensis), Bergflachs (Linum austriacum), Kaninchenfell (Ornithogalum brevistylum), österreichischer Salbei (Salvia austriaca), Hainsalbei (Salvia nemorosa), Österreichischer Ochsenschwanz (Verbascum chaixii subsp. österreichcum) usw. Ex situ vermehrte Art: Frühlingsprimel (Adonis vernalis), rote Zwiebel (Lauch atropurpureum), Traufe Zwiebel (Lauch rotundum), gewöhnlicher Spargel (Spargel officinalis), stachelige imola (Centaurea scabiosa subsp. spinulosa), Steinsaat-Perlhirse (Lithospermum officinale), Widderrankenförmige Veronica (Pseudolysimachion-Orchidee), wilde Rose (Rosa gallica), klein Samenblume (Sternbergia colchiciflora), später Löwenzahn (Taraxacum serotinum), variables Gurgeln (Seselianische Sorte) usw.Einzelheiten in Kürze:
Die Arbeit 2017Es begann mit der Feldsammlung und Reinigung von Vermehrungsmaterial (Samen, vegetative Teile). Anschließend begann im Herbst und Frühjahr 2018 die Saatbeetaussaat, die den Grundstein für die Umsiedlung legte. DER 2018Im Jahr begann die Anzucht der Setzlinge, die im Botanischen Garten SZTE, also ex situ (außerhalb ihres natürlichen Lebensraums), erfolgte. Die Feldsaatsammlung, Reinigung und Vorbereitung der Samen für die Aussaat wurde während der Wachstumsperiode fortgesetzt. Für die erste Verpflanzung und Freilandaussaat 2018 fand im Herbst statt. Wir haben 9.867 Exemplare von 46 Pflanzenarten in einem vorab geplanten Pflanznetz auf fünf ausgewählten Brachflächen in drei Gebieten des Nationalparks (Kígyósi Puszta, Csanádi Puszta, Kardoskúti Puszta) gepflanzt. Wir haben zwei Methoden zur Aussaat verwendet. Einige der Samen wurden nach einem vorgefertigten Raster ausgesät, wobei an jedem Rasterpunkt eine bestimmte Anzahl von Samen einer Pflanzenart platziert wurde. Den anderen Teil der Samen haben wir untergemischt und die entstandene Samenmischung entlang einer Linie verteilt. An der Aussaat und Samenverbreitung waren insgesamt 30 Samenarten beteiligt. DER 2019Im Jahr 2011 wurden die Arbeiten mit der Sammlung der restlichen Brutzellen fortgesetzt. Aus einem Teil des gesammelten Vermehrungsmaterials (Samen, Pflanzenteile) haben wir Setzlinge gezogen und den Großteil der Samen nach der Reinigung und Sortierung für die Aussaat und Streuung vorbereitet. Von 65 Pflanzenarten konnte Vermehrungsmaterial in brauchbarer Menge und Qualität gesammelt werden. Im Herbst wurden auf sechs Brachflächen in unterschiedlichen Regenerationsstadien Umsiedlungen durchgeführt. Insgesamt wurden in den Gebieten der Montág-Puszta, der Kardoskúti-Puszta und der Kígyósi-Puszta gemäß dem geplanten Rasternetz 11.082 Setzlinge gepflanzt. An drei Standorten erfolgte die Aussaat und Saatstreuung, wobei wir über 80.000 Samen verwendet haben. DER 2020-Im Jahr 2011, dem letzten Projektjahr, das die gesamte Vegetationsperiode abdeckt, war es das Ziel, im Antrag noch nicht erfüllte Verpflichtungen umzusetzen. Wir haben 33 Arten in die Samensammlung aufgenommen. Nach der erfolgreichen Ex-situ-Vermehrung haben wir im Oktober-November 70 Arten, insgesamt 10.399 Individuen, auf 6 regenerierenden Brachen in den beiden großen Gebietseinheiten des Körös-Maros-Nationalparks, der Kígyósi Puszta und der Királyhegyesi Puszta, gepflanzt. Bei der Saataussaat und Saatstreuung verteilten wir insgesamt mehr als 130.000 Samen auf die drei Gebiete der Királyhegyes-Steppe und der Kígyósi-Steppe. Auch das Wetter war uns wohl gesonnen, denn die vorangegangenen Regenfälle hatten den Boden ausreichend durchnässt, was das Pflanzen der Setzlinge erleichterte und ihnen zu einem erfolgreichen Anwurzeln verhalf.2021Die letzte Umsiedlung erfolgte im Jahr , wovon das Ausdehnungsgebiet der Lössgraslande von Tompapuszta betroffen war. Insgesamt wurden 504 Setzlinge zufällig über die Fläche verteilt. Die Koordinaten der Anlagen wurden mittels GPS erfasst.
Auch die im Rahmen des Projektes gesammelten und im Saatgutlager des Botanischen Gartens gelagerten Propagule, die letztlich nicht zur Pflanzenvermehrung verwendet wurden (mehr als 250.000 Stück), wurden in den dem Sammelort entsprechenden Regionen verstreut.
Abschließend kann man sagenMit der erfolgreichen Projektabwicklung seitens des Botanischen Gartens konnten wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Gesamt zwischen 2017 und 2021 31 745 Wir sammelten Setzlinge und mehr als 500.000 Propagulae, die auf 4 Teilgebiete des Nationalparks verteilt wurden (die Csanád Puszták, die Kardoskút Fehértó, die Kígyósi Puszta und das Tompapuszta Lössgrasland-Ausweitungsgebiet) jwir wurden ausgewiesen.
Manuelle Samensammlung und Samenstreuung von Pflanzenarten, die im Tompapuszta-Lössgraslandgebiet des KMNP 2023 – 2024 vorkommen.
Das Tompapuszta-Lössgrasland ist das größte Gebiet intakter Lösssteppe in Ungarn. Das alte Grasland steht unter strengem Schutz. Im Rahmen eines neuen Vertrags mit dem Körös-Maros-Nationalpark haben wir uns verpflichtet, während der Vegetationsperiode mehrmals Samen vom Tompapuszta-Lössgrasland zu sammeln und die gesammelten Saatguteinheiten auf den brachliegenden Erweiterungsflächen des Nationalparks auszubringen. Dies wird das Auftreten und die Verbreitung von Lössrasenarten beschleunigen. Durch gezieltes Sammeln von Saatgut wird sichergestellt, dass Saatgut von Zweikeimblättrigen und schwieriger zu besiedelnden Arten rechtzeitig und in ausreichender Menge in die Fläche gelangt und so die Entwicklung eines artenärmeren, von Einkeimblättrigen dominierten Grünlandes vermieden wird.
Die Bruteinheiten wurden per Hand oder mit einer Gartenschere gesammelt, nachdem die Samen auf die richtige Reife geprüft worden waren. Die Saatgutsammlung erfolgt auf einem Niveau, das das Überleben und die natürliche Verbreitung alter Graslandpflanzen nicht gefährdet. Die gesammelten Bruteinheiten wurden per Hand ausgestreut und bedeckten die gesamte Ausbreitungsfläche. Der Nationalpark ergänzte die Saatgutsammlung zudem durch die Heuausbringung. Nach dem Pressen wurde das alte Grünland auf den Brachflächen verteilt.
Die Sammlung umfasste 162 Pflanzenarten, z. B.: Nonea pulla, Anchusa barrelieri, Sternbergia colchiciflora, Phlomis tuberosa, Lavathera thuringiaca, Allium vineale, Hypericum perforatum, Ornithogalum brevistylum, Linum austriacum, Stipa capillata, Vincetoxicum hirundinaria, Crutiata pedemontana, Viola ambigua, Ajuga laxmanni, Rhinanthus rumellicus, Onobrychis arenaria, Dianthus pontederae, Aster sedifolius.
Bei bestimmten Arten, die sich vegetativ gut vermehren, wurden auch Transplantate und im Botanischen Garten vermehrte Ex-situ-Exemplare eingepflanzt, z.B.: Rosa gallica, Fragaria viridis, Vinca herbacea, Anchusa barrelieri, Thymus glabrescens.
Wir werden die Restaurierungsarbeiten im Jahr 2025 fortsetzen.



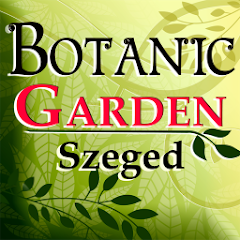
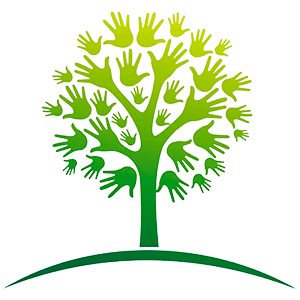 Stiftung für den Botanischen Garten Szeged
Stiftung für den Botanischen Garten Szeged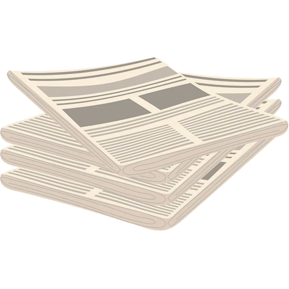 Die Medien berichten regelmäßig über unsere Veranstaltungen und Entwicklungen. Wir sammeln sie hier…
Die Medien berichten regelmäßig über unsere Veranstaltungen und Entwicklungen. Wir sammeln sie hier… Sie können über unsere Veranstaltungen lesen, indem Sie auf den Link klicken
Sie können über unsere Veranstaltungen lesen, indem Sie auf den Link klicken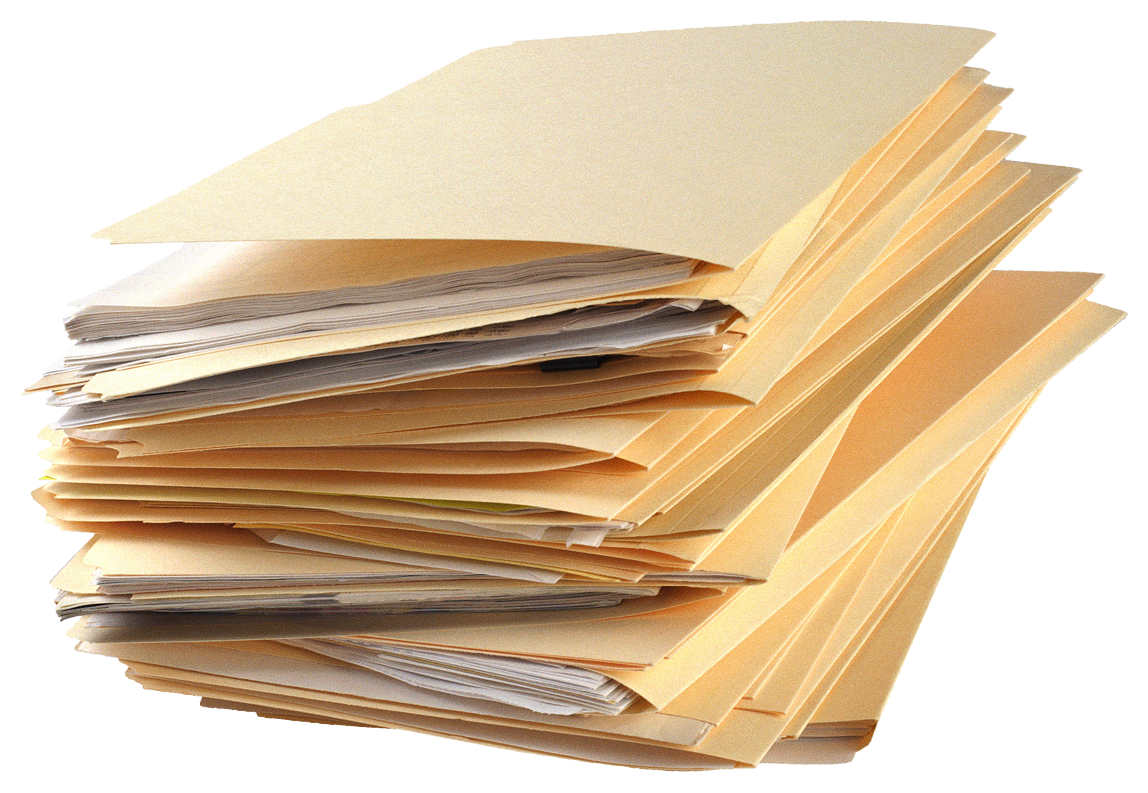 Auch unsere älteren Artikel haben wir nicht gelöscht, schauen Sie in unserem Archiv nach.
Auch unsere älteren Artikel haben wir nicht gelöscht, schauen Sie in unserem Archiv nach.